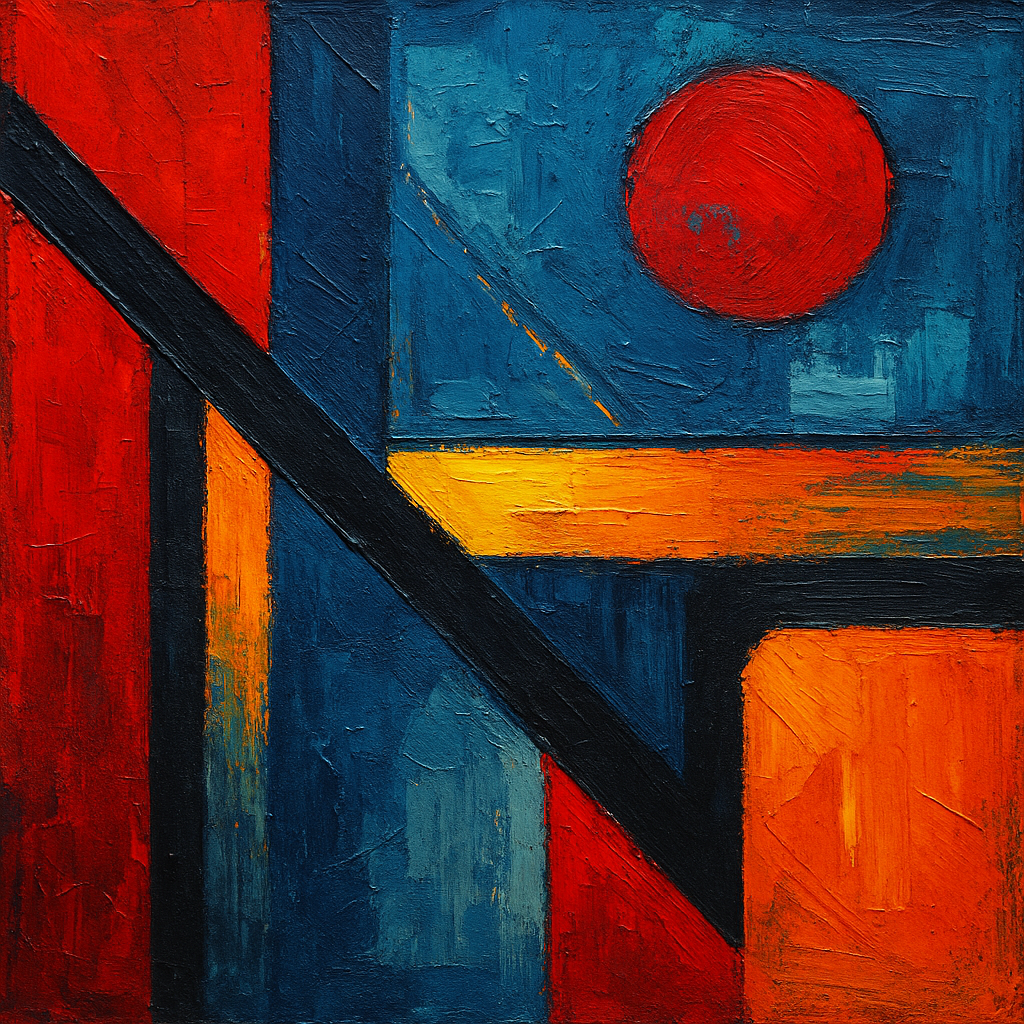
Warum Zölle auf China nicht dasselbe bedeuten wie Zölle auf Europa
Zölle als Symbol geopolitischen Niedergangs oder Selbstbehauptung
In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war China die führende Macht Ostasiens, mit einer gefestigten imperialen Struktur, einer hochproduktiven Agrarwirtschaft und einer Kultur, die sich selbst als das zivilisierte Zentrum der Welt verstand. Der Begriff Zhōngguó (中国) – „Reich der Mitte“ – war keine bloße geografische Bezeichnung, sondern eine politische und kosmologische Behauptung: China sah sich als natürliche Achse der Ordnung, um die sich kleinere Zivilisationen in einer tributären Hierarchie drehten, die sowohl die moralische Überlegenheit als auch die institutionelle Stabilität des Dynastiesystems widerspiegelte.
Ökonomisch war China eine vorindustrielle Fertigungsmacht. Die Landwirtschaft, gestützt auf intensive Techniken und gut entwickelte Bewässerungssysteme, sicherte anhaltende Ernährungssicherheit. Darauf basierten hochentwickelte kunsthandwerkliche Sektoren: Seide, Porzellan und Tee waren nicht nur Luxusgüter in Europa, sondern Symbole einer technischen Leistungsfähigkeit, die der Kontinent bewunderte, ohne sie reproduzieren zu können. Besonders chinesischer Tee wurde ab dem 18. Jahrhundert zur nationalen Obsession für England und machte Anfang des 19. Jahrhunderts 90 % ihrer Importe aus China aus.
Der Handel mit europäischen Mächten war jedoch stark eingeschränkt. Er war nur im Hafen von Kanton (Guangzhou) und unter strikter staatlicher Kontrolle erlaubt. Darüber hinaus zeigte das Reich wenig Interesse an europäischen Produkten, die als minderwertig oder irrelevant für die chinesische Wirtschaft angesehen wurden. Da die Behörden ausschließlich Silber als Zahlungsmittel vorschrieben, entstand ein chronisches Handelsbilanzungleichgewicht: Das Vereinigte Königreich – frisch aus der Industriellen Revolution hervorgegangen – exportierte große Mengen Silber nach China, konnte aber keine vergleichbaren Waren verkaufen. Dieser einseitige Geldfluss schwächte die britischen Reservebestände und entwickelte sich zur strategischen Anomalie, die das Empire, schon mitten in der globalen Expansion, nicht dauerhaft hinnehmen wollte.
Das Britische Empire, über die Britische Ostindien-Kompanie, begann eine Strategie, um die ungünstige Handelsbilanz umzukehren. Es baute Opium in Britisch-Indien an und schmuggelte es über private Händler, unterstützt von der imperialen Diplomatie, illegal nach China. So begann Silber, statt nach China zu fließen, das Land zu verlassen, und Opium wandelte sich von einer Randware zum strukturellen Element der Schattenwirtschaft des Reiches.
Im Jahr 1839 überstiegen die britischen Opiumexporte nach China 1400 Tonnen jährlich. Die Sucht erstreckte sich über alle sozialen Schichten. Angesichts einer gesundheitlichen und moralischen Krise versuchte der Qing-Staat, den Opium-Import zu stoppen. Die britische Antwort war der Krieg. Der Erste Opiumkrieg (1839–1842) endete mit dem Vertrag von Nanking, der die erzwungene Öffnung von Häfen, die Legalisierung von Opium, die Zahlung von Entschädigungen und die Abtretung Hongkongs vorsah. Es folgten weitere ähnliche Verträge.
Die Folgen waren verheerend. Die Wirtschaft wurde zerstört, das Kunsthandwerk brach zusammen, und das soziale Gefüge wurde durch die Ausbreitung der Sucht zerstört. Um 1880 übertrafen die britischen Opiumexporte 6.500 Tonnen jährlich. Schätzungen zufolge war gegen Ende des 19. Jahrhunderts rund 27 % der erwachsenen männlichen Bevölkerung opiumsüchtig. China, einst zivilisatorisches Zentrum, wurde zur fremdbestimmten Wirtschaft und zum zersplitterten Territorium. Opium war nicht nur eine Ware: Es war die unsichtbare Architektur einer strukturellen Kapitulation.
Die wirksame Opiumprohibition kam erst mit der Festigung der Macht der Kommunistischen Partei Chinas 1949. Sie gehörte zu den ersten symbolischen Gesten des neuen Regimes, markierte das Ende der Unterwerfungsperiode und leitete ein souveränes Wiederaufbauprojekt ein. Die Partei stellte sich nicht nur als Siegerin eines Bürgerkriegs dar, sondern als politisches Subjekt, das über ein Jahrhundert ausländischer Demütigungen beenden würde.
Diese Erzählung kristallisiert sich in der Vorstellung des „Jahrhunderts der Demütigung“ (1839–1949), einer historischen und emotionalen Kategorie, die das moderne kollektive Gedächtnis prägt. Die Opiumkriege, ungleiche Verträge, die japanische Invasion und der Gebietsverlust werden als Kette von Enteignungen gelesen, gegenüber denen die Gründung der Volksrepublik nicht nur eine politische Reaktion, sondern eine existentielle Wiedergutmachung ist.
Diese Deutung ist institutionalisiert: Sie wird in den Schulen gelehrt, an Nationalfeiertagen begangen, zieht sich durch Museen, Lehrbücher und Staatsreden. Sie prägt auch die Populärkultur: Filme, Serien, Romane und Videospiele rekonstruieren Episoden von Besatzung und Widerstand. Die vermittelte Idee ist deutlich: Die Demütigung war nicht das Ende, sondern der Ursprung eines neuen nationalen Bewusstseins.
Trumps Zölle als Spiegelbild: Wo der Westen an Sinn verliert, findet China Bestätigung
Im Jahr 2025, wenn die Regierung von Donald Trump eine neue Welle von Zöllen nicht nur gegen China, sondern auch gegen alte Verbündete wie Deutschland, Japan oder Frankreich verhängt, bricht im Westen nicht nur ein Handelsabkommen, sondern das Gründungsnarrativ des liberalen Kapitalismus, der seit dem Zweiten Weltkrieg auf Axiomen wie Freihandel, Marktoffenheit, politischer Neutralität der Wirtschaft und Interdependenz als globalem Ordnungsprinzip basiert.
Der Einsatz des Protektionismus als strategische Waffe gegen Alliierte durchbricht die Logik des gegenseitigen Nutzens und offenbart eine Kluft zwischen verkündeten Prinzipien und tatsächlicher Machtausübung. Für Europa und andere traditionelle US-Partner bedeuten Zölle mehr als wirtschaftlichen Verlust: Sie sind ein symbolischer Schlag. Der Garant der liberalen Ordnung garantiert sie nicht mehr. Der Markt erscheint nicht mehr als neutraler Raum: Er wird zum Schlachtfeld.
Für China hingegen wirkt eben diese Geste als Bestätigung. Die Kommunistische Partei betrachtet den Markt nicht als autonome Entität, sondern als Werkzeug des Staates. Seit 1949 verbindet das chinesische Modell staatliche Planung, selektiven Schutz und kontrollierte Öffnung. Die Reformen zielen nicht darauf ab, sich der globalen Ordnung unterzuordnen, sondern sich einzugliedern, ohne die Kontrolle über strategische Entscheidungen abzugeben.
Der Plan „Made in China 2025“, vor über einem Jahrzehnt gestartet, um die technologische Abhängigkeit zu verringern und Schlüsselsektoren zu dominieren, hat bereits über 86 % seiner Ziele erreicht. China ist weltweit führend bei Hochgeschwindigkeitszügen, Batterien, Solarmodulen, Robotik und Elektrofahrzeugen. Sanktionen schwächen diese Politik nicht: Sie beschleunigen sie. Das Decoupling überrascht China nicht: Es ist Bestandteil ihres Grundszenarios. Was der Westen als Krise erlebt, wird in China als Bestätigung erfahren.
Das chinesische Narrativ schwächt sich im Konflikt nicht ab: Es manifestiert sich als Ausdruck einer über lange Zeit aufrechterhaltenen historischen Konsistenz. Im 19. Jahrhundert setzte eine ausländische Macht den Handel ein, um die Souveränität zu untergraben; heute, angesichts neuer Formen ökonomischen Drucks, sieht China darin keine Zäsur, sondern die Bekräftigung der Prinzipien, die es seit über sieben Jahrzehnten kontinuierlich pflegt. Diese Grundlagen sind nicht nur strategischer, sondern auch historischer, kultureller und moralischer Natur und formen seit 1949 das nationale Projekt. Während im Westen Zölle einen Bruch zwischen den Gründungsprinzipien des Freihandels und der tatsächlichen Machtausübung markieren, wirken sie in China wie die Bestätigung eines Weltbilds, das Ökonomie und Politik, Souveränität und Entwicklung nie trennt. In dieser Asymmetrie der Interpretation prallen nicht nur zwei Modelle aufeinander; sie repräsentiert auch zwei verschiedene Horizonte: Zwischen denen, die einen Wendepunkt erleben, und denen, die im Konflikt die Bestätigung von Kontinuität und Aufstieg erkennen.